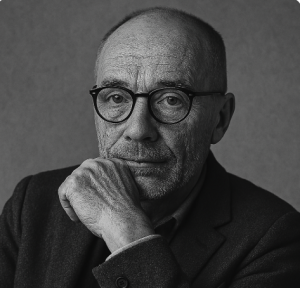Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Seit Jahrhunderten hängt unser Wohl und Wehe von Fakten ab. Tatsachen, die uns durch das Dickicht des Lebens führten wie ein sicherer Pfad im düsteren Wald. Wer sich in einem Gespräch über das Weltgeschehen mit der Behauptung begnügte, „ich habe gehört“, „man sagt“ oder „es könnte sein“, galt als uninformiert, wenn nicht gar naiv. Einfache Dinge wie „Die Erde ist rund“ oder „Der Himmel ist blau“ wurden nicht hinterfragt, sondern als allgemeingültige Wahrheiten akzeptiert – bis wir auf eine neue, radikale Idee stießen: die Post-Wahrheit.
Es war wohl der erste Schrei der Post-Wahrheit, als im amerikanischen Wahlkampf 2016 der Begriff aufkam. Post-Wahrheit? Nun, es gab wahrhaftig eine Zeit, als der Begriff der Wahrheit in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft etwas bedeutete. Eine Zeit, in der Lügen – wenn sie aufflogen – schamhaft entlarvt wurden. Doch heute erleben wir das Gegenteil. Lügen und alternative Fakten haben sich zu einer neuen Normalität gemausert. Die Distanz zwischen dem, was uns als Fakten serviert wird, und dem, was wir als Wahrheit verstehen, hat sich derart aufgeweitet, dass wir nicht mehr wissen, was eigentlich noch wahr ist.
Man könnte sagen, die neue politische Ära hat eine Epoche eingeläutet, in der die Wahrheit zur Verhandlungsmasse geworden ist – ein verhandelbares Gut, das nach Belieben zurechtgebogen werden kann, je nachdem, wer gerade die Macht hat, die Geschichte zu schreiben. Was früher als objektive Wahrheit galt, ist heute oft eine Illusion, die von den sozialen Medien in ein beliebtes Narrativ verwandelt wird. Diejenigen, die sich an Fakten klammern, fühlen sich wie die letzten Verfechter eines längst untergegangenen Ideals.
Doch was genau ist eigentlich passiert? In der Welt vor der Post-Wahrheit war der Zugang zu Wissen noch ein eher beschränkter, doch heute, im digitalen Zeitalter, haben wir Zugang zu einem nahezu unerschöpflichen Fundus von Informationen. Wissen war und ist Macht – das haben schon die alten Denker gewusst. Aber was passiert, wenn dieser Fundus sich als ein unendlich großer Müllhaufen herausstellt? Wenn sich in der Flut von Daten und Informationen kein klarer Unterschied mehr zwischen Fakt und Fiktion ausmachen lässt?
Die Antwort ist banal und zugleich erschreckend: Der Mensch gerät in Panik. Er sucht nach einem festen Anker in einer immer chaotischer werdenden Welt, nach einer Wahrheit, die mehr ist als bloße Information. Doch in einer Zeit, in der jeder, der einen Internetzugang hat, sich als Wissender gerieren kann, wird der Zugang zur Wahrheit zur Wundertüte. Wer den Finger auf einen Bereich des Wissens legt, muss sich der Gefahr aussetzen, in einen Sumpf aus Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu geraten.
Die postfaktische Ära hat damit eine beispiellose Verunsicherung erzeugt. Denn was ist das, was uns in unserer Gesellschaft eigentlich unsicher macht? Es ist der Verlust des Vertrauens in die Grundlage unserer Kommunikation: in Fakten. Wer heute noch versucht, sich an eine fundierte Quelle zu halten, begibt sich auf einen mühsamen und oft frustrierenden Weg. Nicht selten stößt er auf eine Mauer aus Negationen und Alternativmeinungen. Am Ende bleibt nur das Gefühl der Enttäuschung, der Resignation und, ja, der Angst vor der Zukunft.
Diese Entwertung der Wahrheit, die wir heute erleben, ist nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Wandels der Gesellschaft. Die alte Ordnung, in der Institutionen wie die Wissenschaft, die Politik und die Medien als Hüter der Wahrheit fungierten, ist brüchig geworden. Die Grundlage dieses Wandels liegt in einem scheinbar harmlosen Trend: der Demokratisierung der Information. Heute hat jeder eine Stimme, jeder kann sich äußern und veröffentlichen, was ihm in den Sinn kommt. So entstand der Mythen-Dschungel der sozialen Netzwerke, in dem Fakten schwerer zu finden sind als goldene Nuggets im Dreck.
Die neue Freiheit, sich mit einer unüberschaubaren Menge an Informationen zu versorgen, hat paradoxerweise dazu geführt, dass die Menschen weniger Wissen haben, weniger Verständnis und weniger Orientierung. Denn was nützt es, wenn jeder sein eigenes Bild der Welt im Internet zusammenbasteln kann, ohne dabei auf objektive Wahrheiten Rücksicht nehmen zu müssen? Wo liegen noch die objektiven Kriterien, um zu entscheiden, was wahr ist und was nicht? Wo ist die Autorität, die uns sagt, wie wir die Welt verstehen sollen?
Die Politik hat den Wandel längst erkannt und sich dem neuen Spiel angepasst. Längst ist die Grenze zwischen Fakten und Fiktion verwischt, die Wahrheit ist zum Spielball geworden. Wer seine Anhänger mobilisieren möchte, bedient sich nicht mehr der Fakten, sondern der Erzählungen, die die Menschen am meisten emotional aufwühlen. Die Politik der Post-Wahrheit funktioniert nicht mehr durch Überzeugung, sondern durch emotionale Manipulation. Sie setzt auf Ängste, auf Unsicherheiten, auf das Bedürfnis nach einem Feindbild.
Und was tun wir als Gesellschaft in dieser Situation? Wir sind verunsichert, orientierungslos. Wir, die wir früher dachten, dass es eine feste Grundlage für alles gibt, dass es Fakten gibt, auf die wir uns verlassen können, fühlen uns von der Welt entfremdet. Wir suchen nach einfachen Lösungen, nach klaren Antworten, nach jemandem, der uns sagt, was wahr ist. Doch die Welt ist nicht mehr so einfach, und die Antworten sind immer schwerer zu finden.
In der Vergangenheit gab es ein gewisses Vertrauen in Experten. Wenn jemand etwas über das Klima wusste, dann waren es Klimaforscher, die sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt hatten. Wenn jemand über den aktuellen Stand der Wissenschaft Bescheid wusste, dann waren es Physiker, Chemiker, Biologen. Heute sind Experten jedoch die neuen Feindbilder, die neuen Vertreter einer als elitär empfundenen Wissensgesellschaft. Die Post-Wahrheit hat die Experten zu Verdächtigen gemacht – zu denen, die ihre eigenen Interessen vertreten, die nicht die „wahre Wahrheit“ sagen, sondern das verkaufen, was den Mächtigen nützt.
Es ist kein Zufall, dass in Zeiten der Post-Wahrheit auch das Vertrauen in Institutionen drastisch gesunken ist. Parteien, Medienhäuser, Wissenschaftler, selbst die Polizei und das Gesundheitssystem – sie alle haben an Glaubwürdigkeit verloren. Sie gelten nicht mehr als Hüter der Wahrheit, sondern als Akteure im Spiel der politischen und ökonomischen Machenschaften. Und je mehr wir in einem Netz von Lügen und verzerrten Wahrheiten gefangen sind, desto weniger wissen wir, wem wir noch vertrauen können.
Die Verunsicherung, die sich aus dieser Situation ergibt, ist die Grundlage unserer Zukunftsangst. Wenn wir nicht wissen, was wahr ist, wie können wir dann eine vernünftige Vorstellung von der Zukunft entwickeln? Wenn Fakten nichts mehr wert sind und die Wahrheitsfindung zu einem Beliebigkeitsprozess verkommt, wie sollen wir dann unsere Welt gestalten? Und die Zukunft? Sie wird nicht mehr als das verheißungsvolle Ziel einer fortschreitenden Entwicklung betrachtet, sondern als ein bedrohliches Unbekanntes, das wir nicht mehr zu begreifen wissen.
Es sind diese Ängste, die das Denken der Post-Wahrheits-Gesellschaft prägen. Was in der Vergangenheit als fest und unumstößlich galt, ist jetzt verhandelbar. Der Zweifel an der Wahrheit wird zur Norm, und der Weg der objektiven Erkenntnis wird mehr und mehr zu einer Entgleisung. Die Angst vor der Zukunft in einer Welt ohne klare Wahrheiten ist nicht nur ein Problem der Politik oder der Wissenschaft, sondern ein zutiefst gesellschaftliches Problem. Es ist eine Frage der Orientierung und des Vertrauens. Und ohne diese Elemente können wir nicht in eine Zukunft blicken, die wir selbst gestalten können.
In einer Welt, in der die Wahrheit beliebig geworden ist, bleibt uns nur die Erkenntnis, dass wir uns auf uns selbst besinnen müssen. Wir müssen lernen, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden, müssen wieder Vertrauen in das Wissen aufbauen, das uns hilft, die Welt zu verstehen. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, der Zukunftsangst zu entkommen: Indem wir uns nicht von den Sirenen des Populismus und der Desinformation verführen lassen und uns wieder auf die Wahrheit besinnen – nicht als eine feste, endgültige Antwort, sondern als eine gemeinsame, immer wieder zu erarbeitende Erkenntnis.
Doch bis dahin bleibt die Frage: In welcher Welt wollen wir leben? In einer Welt, in der die Wahrheit zum Spielball der Mächtigen wird, oder in einer Welt, in der wir uns bemühen, die Fakten zu retten und zu wahren? Die Zukunft hängt von der Antwort auf diese Frage ab.