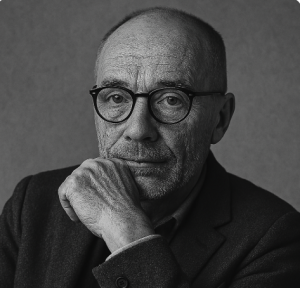Es war einmal eine Zeit, da war der Mensch der König der Welt, und die Welt war der Stoff, aus dem seine Träume gewebt wurden, ein endloser, nie endender Strom von Geschichten, Mythen und Metaphern. Doch heute, da der Mensch seinen Thron längst an Maschinen abgegeben hat, scheint die Welt nicht mehr der Stoff zu sein, aus dem seine Träume gewebt werden, sondern der Stoff, aus dem seine Simulationen sind. Dies ist die paradoxe Tragödie des 21. Jahrhunderts: Während die Technologien, die unser Leben bestimmen, uns die Welt in einer nie dagewesenen Intensität und Präzision vor Augen führen, entfernen sie uns zugleich von ihr. Nicht nur räumlich und zeitlich, sondern existenziell. Die Grenzen zwischen dem, was real ist, und dem, was simuliert ist, verschwimmen in einem Maße, dass man sich fragt, ob der Mensch in seinem eigenen Leben noch zu Hause ist, oder längst zu einem Gast in einer Welt geworden ist, die er selbst erschaffen hat – und die er nun nicht mehr versteht.
Vielleicht ist der Moment gekommen, in dem wir uns eingestehen müssen, dass die Entfremdung, von der wir so lange sprachen, keine abstrakte Größe mehr ist, sondern längst eine tägliche, greifbare Erfahrung geworden ist. Die Entfremdung von der Arbeit, vom Leben, von der Gesellschaft – all das waren Kategorien, die in der vergangenen Jahrhundertwende in den diskursiven Raum geworfen wurden, aber heute geht die Entfremdung tiefer, viel tiefer. Heute entfremden wir uns von der Welt selbst. Die Frage ist nicht mehr, wie der Mensch seine Arbeit und sein Leben organisiert, sondern wie er die Welt, die ihn umgibt, überhaupt noch wahrnimmt. Und genau hier kommt die Simulation ins Spiel.
Simulationen – in Form von sozialen Medien, Computerspielen, virtuellen Welten und all den anderen schillernden Erscheinungen der digitalen Sphäre – haben einen Grad der Authentizität erreicht, dass sie den Platz der „realen“ Welt eingenommen haben. Sie sind nicht mehr nur einfache Abbildungen, sondern vollwertige Welten, in denen Menschen leben, lieben, arbeiten und sich streiten. Die Grenze zwischen dem, was real und was simuliert ist, wird durch diese Welten zunehmend durchlässig, bis sie schließlich zu einem vagen Nebel verschwimmt, in dem sich niemand mehr zurechtfindet.
Die Frage ist: Was bleibt uns von der „realen“ Welt, wenn wir uns in diesen simulierten Welten verlieren? Was bleibt uns von der Natur, von der Gesellschaft, von der Politik, wenn alles, was wir sehen, hören und fühlen, nur noch die Hülle einer Simulation ist? Wenn wir auf Facebook ein „Gefällt mir“ bekommen, ist es dann noch ein echtes Zeichen der Anerkennung oder bloß eine mechanische Bewegung im unendlichen Rausch der algorithmischen Zyklen? Wenn wir in einem Computerspiel einen Feind besiegen, haben wir dann tatsächlich etwas gewonnen oder nur die nächste Stufe eines niemals endenden Spiels erreicht, dessen Regeln von uns selbst bestimmt wurden?
Die Antwort auf diese Fragen ist natürlich alles andere als einfach. Es ist einfach, die Virtualität und die Simulation zu verteufeln und die alte, „echte“ Welt zu verherrlichen. Es ist einfach, die soziale Medien-Ökonomie als „Fake“ abzustempeln und uns in eine vermeintlich bessere Zeit zurückzuwünschen, in der alles noch „authentisch“ war. Doch dies ist nur eine flüchtige Reaktion, eine Flucht vor der eigentlichen Frage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der „realen“ Welt und der „simulierten“ Welt? Und warum, um Himmels willen, sind wir so besessen von diesem Unterschied?
Die Antwort auf diese Frage ist tief in der Geschichte unserer eigenen Wahrnehmung verwurzelt. Wir haben es mit einer Kultur zu tun, die sich über Jahrhunderte in einem ständigen Spiel von Realität und Illusion bewegt hat. Die Philosophen der Aufklärung prahlten mit ihrer Fähigkeit, die Welt in ihrer „reinen“ Form zu erkennen, ohne die Verschleierungen von Mythen und Aberglauben. Die Künstler der Moderne schließlich suchten nach neuen Formen der „Wahrheit“, die jenseits der bisherigen Darstellungsformen existieren sollten. Sie entdeckten, dass es keine einzige Wahrheit gibt, sondern viele Wahrheiten, die sich in immer neuen, unaufhörlich sich wandelnden Bildern manifestieren. Doch in all diesem Suchen nach einer „wahren“ Welt haben wir möglicherweise das Wesentliche aus den Augen verloren: Vielleicht gibt es überhaupt keine „wahre“ Welt, die von einer „illusorischen“ Welt zu unterscheiden ist. Vielleicht ist alles immer schon eine Simulation.
Aber was genau meinen wir, wenn wir von „Simulation“ sprechen? Was bedeutet es, dass die Welt nicht mehr „real“, sondern simuliert ist? Zunächst einmal muss man verstehen, dass Simulation nicht dasselbe ist wie Illusion. Eine Illusion ist eine verzerrte Wahrnehmung der Welt, die uns an der Wirklichkeit vorbeiführen kann, während eine Simulation absichtlich und mit einem bestimmten Zweck erschaffen wird. Eine Simulation ist kein Fehler, keine Täuschung, sondern eine Art der Konstruktion. Sie ist eine Antwort auf die Frage: Was passiert, wenn die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr genug ist? Wenn das, was wir als „wirklich“ empfinden, in einem unaufhörlichen Strom von Bildern und Informationen zerfällt? Wenn die Welt in einer Flut von Zeichen versinkt, deren Ursprung und Bedeutung wir nicht mehr erkennen können?
In dieser Hinsicht ist die Simulation keine Flucht vor der Realität, sondern ihre radikale Neuinterpretation. Sie ist der Versuch, das Leben in einer Welt der Unbestimmtheit und Widersprüche zu begreifen, indem man es neu zusammensetzt, in einer Form, die uns mehr Kontrolle über das Unkontrollierbare zu geben scheint. Sie ist die Antwort auf den Verlust des Verhältnisses zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir wissen. Doch dieser Versuch, die Welt zu simulieren, um sie zu begreifen, führt uns nicht zu einer tieferen Einsicht in ihre Wahrheit, sondern zu einer immer größeren Entfremdung von ihr.
Es ist kein Zufall, dass wir die simulierten Welten zunehmend als „realer“ erleben als die reale Welt. Vielleicht liegt das daran, dass die Simulation uns etwas verspricht, was die „echte“ Welt nicht mehr liefern kann: Kontrolle. In der simulierten Welt sind wir nicht Opfer des Zufalls, der Komplexität oder der Unvorhersehbarkeit. Wir sind die Schöpfer unserer eigenen Realität, die Herrscher über eine Welt, die genau nach unseren Wünschen funktioniert – zumindest für eine kurze Zeit. Die Simulation ist der Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Ordnung und Verstehbarkeit in einer Welt, die von Natur aus chaotisch und unüberschaubar ist.
Doch in diesem Streben nach Kontrolle geht etwas verloren. Wir entgleiten der Wirklichkeit, nicht weil wir uns vor ihr verstecken, sondern weil wir ihre Züge nicht mehr erkennen. Wenn das Leben nur noch eine Simulation ist, dann verlieren wir den Bezug zu dem, was es bedeutet, „zu leben“. Die virtuellen Welten mögen uns ein gewisses Maß an Kontrolle und Gewissheit geben, doch sie nehmen uns etwas Wesentliches: die Erfahrung der Zufälligkeit, der Unvorhersehbarkeit, der Überraschung – jener Dinge, die das Leben in seiner rohen, ungefilterten Form ausmachen.
So stehen wir also vor einer paradoxen Situation: Die Simulation, die uns verspricht, die Welt zu beherrschen, entfremdet uns zugleich von der wirklichen Welt, indem sie uns die Erfahrung der Wirklichkeit verweigert. Und doch ist diese Entfremdung keine neue Erscheinung. Sie ist das Erbe einer langen Tradition der westlichen Kultur, die stets nach Möglichkeiten suchte, die Welt zu kontrollieren und zu beherrschen, nur um am Ende zu erkennen, dass sie sich selbst dabei verloren hat. Die virtuelle Realität, das Spiel mit den Simulationen, ist nur die neueste Manifestation dieses uralten Traums, der uns immer weiter von dem entfernt, was wir zu begreifen hoffen.
In einer Welt, in der alles simuliert und nichts mehr „wirklich“ ist, bleibt die Frage: Gibt es noch einen Platz für den Mythos?