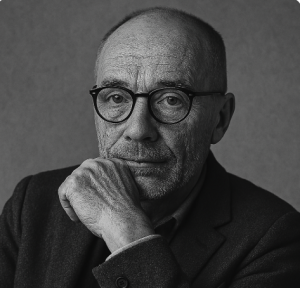Die Generation der Gegenwart ist ein schwankendes Pendel, das, obgleich durch die Weiten der modernen Welt und die Strömungen der Gegenwartsmärkte unablässig hin und her geworfen, immer wieder auf eine zentrale Frage trifft: „Warum?“ Sie ist eine Generation, die sich durch die Paradoxie auszeichnet, einerseits alles zu hinterfragen, andererseits nicht zu wissen, woran sie sich halten soll. Sie bewegt sich zwischen Nihilismus und Utopie, zwischen der Verweigerung von Sinn und dem unaufhörlichen Drang nach einer besseren Welt.
Es ist nicht zu übersehen, dass wir in einer Zeit leben, in der Ideale und Visionen – in ihren besten Formen einst treibende Kräfte der Geschichte – zu wackeligen, abstrahierten Konzepten verkommen sind. Die große Erzählung von Fortschritt, von einer klaren Linie zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, scheint in ihren Grundfesten erschüttert. Die Welt, die uns als die der unbegrenzten Möglichkeiten versprochen wurde, hat sich vielfach in ein knöchern zersplittertes Terrain verwandelt, in dem jeder Hoffnungsschimmer der Fortschrittlichkeit einer nüchternen Realität gewichen ist. Umso mehr spürt man in der Jugend von heute eine ständige Bewegung, eine Unruhe, die fast nichts zu beruhigen weiß.
Die Verweigerung von Sinn – oder, besser gesagt, das fortwährende Hinterfragen dessen, was für sinnvoll gehalten wird – ist ein Phänomen, das sich insbesondere in den letzten Jahrzehnten gefestigt hat. Die Bedenken der Generation Z, der Millenials, ja, die der gesamten nachfolgenden Generationen, richten sich nicht nur gegen die politische und gesellschaftliche Ordnung, sondern auch gegen die grundlegenden Annahmen über das Leben selbst. Die Welt ist ein pulsierendes Netzwerk aus unaufhörlichen Reizen, die unablässig in den digitalen Raum strömen, doch der Sinn dieser Reize bleibt im Nebel des Unklaren und Fragmentierten verstrickt. In einer Welt, in der der Erfolg von Influencern und der „Like“-Button oft zu den bedeutendsten Maßstäben des Lebensstils zählen, erscheint der tiefe, unverfälschte Sinn des Lebens als etwas Altmodisches, beinahe nostalgisch.
Die Digitalisierung hat ihre Opfer gefordert, und die Sprache von Bedeutung, die vor einigen Jahrzehnten noch als klar definiert galt, hat sich weitgehend aufgelöst. Der Weg des Wissens, des Lernens, der Bildung ist nicht mehr der alte, gradlinige Prozess des Erwachsenwerdens, sondern ein ständiges Schwanken und Umherirren im Dschungel der Informationen. Diese Welt ist voller Verweise auf alles und nichts zugleich, eine grenzenlose Anhäufung von Daten, die wenig mit der Kernfrage des Daseins zu tun haben. In der Vergangenheit wurde das Wissen als eine Waffe im Kampf gegen die Ohnmacht verstanden; heute ist es ein Spielball der Unbestimmtheit geworden.
Und dennoch: Trotz dieser Leere gibt es eine andere Seite dieser Generation. Denn so viel in der Art der Lebensgestaltung und des sozialen Zusammenlebens unklar und fragmentiert erscheint, so viel sind die Menschen von heute doch von einem tiefen Bedürfnis nach Veränderung und einem Leben in einer besseren Welt beseelt. Die politische Unruhe, die den Planeten nach den letzten großen Krisen immer wieder erschüttert hat, hat den Drang nach einer Alternative, nach einer Utopie, verstärkt. Doch was ist diese Utopie, die immer wieder in den Gesprächen auftaucht, in den Manifesten, in den Tweets und in den Träumen der Generation? Es scheint eine Utopie zu sein, die keiner festen Form mehr zu folgen vermag, die sich von der klaren, fast dogmatischen Vorstellung einer besseren Welt gelöst hat, um sich zu einer Art nebulösem Wunsch nach Umgestaltung zu entgrenzen.
Vielleicht liegt der Ursprung dieser Utopie in einer grundlegend neuen Sichtweise des Menschen, vielleicht auch in der Flucht vor der erdrückenden Realität. Eine Welt, in der das „Wohlstand durch Arbeit“ nicht mehr als ein glaubwürdiges Konzept erscheint, eine Welt, in der das ökologische Desaster und die Unbeständigkeit der ökonomischen Strukturen immer bedrohlicher werden, treibt die Suche nach einem neuen Weltentwurf voran. Doch dieser Entwurf, diese „bessere“ Welt, bleibt in vielerlei Hinsicht unbestimmt. In einer Gesellschaft, die zunehmend auf Individualität setzt und in der kollektive Bewegungen die wahre Identität des Einzelnen zu gefährden drohen, kann die Utopie nur ein flimmerndes Versprechen sein. Sie ist ein Bild, das immer dann am klarsten erscheint, wenn die Augen von der Realität abgewendet sind, wenn der Blick den Horizont der Existenz streift, ohne sich in den Details des Alltags zu verlieren.
Die Zerrissenheit dieser Generation wird auch durch die ständigen Spannungen zwischen sozialem Engagement und persönlicher Freiheit verstärkt. Auf der einen Seite steht die Möglichkeit, durch das Internet und die sozialen Medien die Welt zu beeinflussen, Meinungen zu verbreiten, Solidarität zu zeigen und Gemeinschaften zu bilden. Auf der anderen Seite steht die Neigung zur Selbstgenügsamkeit, zur Inszenierung des eigenen Lebens als Performance, in der alles, was wahrgenommen wird, lediglich ein weiteres Produkt zur Selbstvermarktung darstellt. Hier liegen die Spannungen der Gegenwart, die den ewigen Gegensatz zwischen kollektiver Verantwortung und individueller Selbstverwirklichung immer wieder auf die Spitze treiben.
Es ist, als ob der Nihilismus dieser Generation – ihr Zweifel an der Möglichkeit einer wahren, tiefen Bedeutung – eine andere Seite offenbart. Eine Seite, die den Wunsch nach einer Utopie, nach einer Verbesserung der Welt, in sich trägt, aber dieser Wunsch ist nicht mehr jener eines Glaubens an den Fortschritt. Es ist der Wunsch nach einer Erhebung, einer Auflösung der bestehenden Widersprüche, der Welt im Chaos der Konsumgesellschaft, der Welt der Scham und der Verzweiflung, die immer wieder das Versprechen eines besseren Lebens in die Ferne rückt.
Die politische Dimension dieses Dranges nach einer besseren Welt kann dabei nicht ausgeklammert werden. Wo einst die großen Bewegungen die politische Landschaft dominierten, da sind heute neue, dezentrale Bewegungen entstanden. Sie sind weniger ideologisch in der klassischen Sinne, weniger festgefahren und schwerfällig, vielmehr sind sie schnell, digital und oft so flüchtig wie der Moment, der sie hervorgebracht hat. Das ist der Widerspruch unserer Zeit: Der Wandel wird nicht mehr als eine klare Linie verstanden, sondern als eine ständige Bewegung, die stets im Fluss bleibt und sich weder festlegen noch entschlüsseln lässt.
Trotz dieser fluiden Natur gibt es in all dem eine tiefe Sehnsucht nach Erneuerung. Die Generation von heute hat das Gefühl, dass die Welt nicht so bleiben kann, wie sie ist. Dass die Verhältnisse, die unser Leben bestimmen, nicht weiter Bestand haben dürfen. Und diese Sehnsucht hat ihre Wurzeln in der Art und Weise, wie wir heute über uns selbst und die Welt denken. Die moderne Entfremdung hat ihr eigenes Gegenteil hervorgebracht: die ständige Forderung nach der Rückkehr des „Sinns“, das Streben nach einem größeren Zusammenhang. Doch auch dieser Streben ist ein paradoxes: Je mehr nach einer besseren Welt verlangt wird, desto mehr wird die Frage nach dem „Warum“ erdrückend.
Es ist eben genau das, was die Generation von heute zu einem in sich selbst widersprüchlichen, chaotischen Konstrukt macht. Sie ist in einer Welt, die nicht mehr an die Möglichkeit des Fortschritts glaubt, und doch auf der Suche nach einer besseren Zukunft, die sich nicht im traditionellen Rahmen von Ideologien und Systemen fassen lässt. Sie ist zwischen der Verweigerung des Sinns und dem Drang nach einer Utopie gefangen – und genau in diesem Spannungsfeld entsteht die Energie, die die Welt von morgen gestalten könnte. Eine Energie, die, wenn auch verworren und fragmentiert, die Möglichkeit in sich trägt, das Alte zu überwinden. Sie könnte die Grundlage für einen neuen Entwurf der Welt sein, in dem Nihilismus und Utopie nicht mehr als Gegensätze bestehen, sondern als zwei Seiten derselben Medaille.