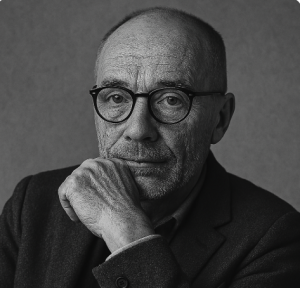Es ist ein furchtbares Schauspiel, das wir gegenwärtig erleben: Der politische Diskurs, der sich einst durch seine Differenziertheit und Sachlichkeit auszeichnete, hat zunehmend seine Mitte verloren. Was wir heute sehen, sind ideologische Blockaden, die kaum noch auf Überzeugungen oder Argumente, sondern vor allem auf Emotionen und Stammtischparolen beruhen. Doch was passiert, wenn die Mitte des Dialogs, das verbindende Element zwischen den Extremen, immer weiter wegrückt? Was passiert, wenn die Kunst des Ausgleichs, der Kompromiss und die Fähigkeit, auf den anderen zuzugehen, zur reinen Nostalgie verkommt?
Es begann schleichend. Zunächst hatte man noch das Gefühl, dass sich der politische Diskurs vielleicht ein wenig auf die Ränder verschoben hatte, dass der Ton rauer, die Argumente polemischer und die Diskussionen heftig wurden. Doch inzwischen sind wir in einem Stadium angekommen, in dem es keine wirkliche Kommunikation mehr gibt, sondern nur noch Monologe der jeweiligen Lager. Wer sich der politischen Mitte zugehörig fühlt, dem wird schnell der Vorwurf gemacht, nicht mutig genug zu sein, nicht klare Kante zu zeigen oder gar das „System“ zu stützen. Wer sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wird als „Rechts“ oder „Links“ etikettiert, was längst nicht mehr eine Beschreibung von politischen Überzeugungen ist, sondern der Versuch, Menschen in Feindbilder zu zwingen.
Und so wird der Diskurs von einer zunehmenden Ideologisierung und Polarisierung beherrscht. Die Medien spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sie – befeuert durch die Algorithmen sozialer Netzwerke – längst nicht mehr das „neutrale“ Sprachrohr sind, das die Mitte erreichen soll, sondern dass sie ein Publikum suchen, das ihre Sichtweisen bereits teilt. Der Journalismus hat sich in weiten Teilen zu einer „Filterblase“ entwickelt, in der die Stimmen der anderen Seite kaum noch gehört werden. Das führt zu einer Verdichtung von Argumenten, die kaum mehr hinterfragt werden, die vielmehr als unumstößliche Wahrheiten hingestellt werden.
Die politische Mitte – das, was einst das Rückgrat der politischen Kommunikation war, die „vernünftige“ Position, die das Land zusammenhielt – gerät immer mehr in den Hintergrund. Sie ist zu einem reliktischen Überbleibsel aus besseren Zeiten geworden, als noch der Konsens, das Gespräch, der Kompromiss gesucht wurde. Und das ist ein Problem, das über die Inhalte hinausgeht. Es geht nicht mehr nur darum, was wir denken, sondern vor allem darum, wie wir miteinander reden.
Das schlimmste Szenario, das sich hier abzeichnet, ist der Verlust der Fähigkeit, überhaupt noch zuzuhören. Wer sich einmal mit den Argumenten des anderen auseinandersetzt, gerät schnell ins Abseits. Wer nicht auf der eigenen Linie bleibt, wird beschuldigt, die falsche Seite zu vertreten. Dabei sind es gerade die Nuancen, die in der Mitte des politischen Spektrums zu finden sind, die wichtig sind. Diese Nuancen sind es, die den Unterschied zwischen einer verantwortungsvollen Politik und einer, die sich im Populismus verliert, ausmachen.
Ein Beispiel für diese verhängnisvolle Entwicklung sehen wir in der Diskussion um Migration. Lange Zeit war es möglich, über die Herausforderungen der Zuwanderung sachlich zu diskutieren, Lösungen zu suchen, die sowohl den Bedürfnissen der Zuwanderer als auch den Interessen der einheimischen Bevölkerung gerecht wurden. Doch heute ist diese Diskussion kaum noch möglich, ohne dass sie sofort in eine „Pro“ oder „Contra“-Haltung übergeht. Wer auf der einen Seite für mehr Offenheit plädiert, wird schnell als „Gutmensch“ abgetan, der die Realität nicht sehe. Wer hingegen Bedenken äußert oder eine striktere Migrationspolitik fordert, wird gleich als xenophob oder rassistisch abgestempelt. Die Mitte, die versucht, beide Seiten zu verstehen und einen Dialog zu führen, ist verschwunden.
Dasselbe Phänomen beobachten wir auch in anderen Bereichen – etwa in der Klimadebatte. Während die einen die drohende Klimakatastrophe nicht ernst genug nehmen können, werfen die anderen den vermeintlichen Klimaleugnern vor, die Wissenschaft zu missachten. Der Dialog zwischen den Lagern besteht nicht mehr darin, gemeinsam Lösungen zu finden, sondern sich gegenseitig zu beschimpfen. Und was bleibt übrig? Ein entpolarisierter Diskurs, der weder die Ideen des einen noch des anderen berücksichtigt und nur noch mit einer völlig übersteigerten Rhetorik arbeitet.
Was ist also zu tun? Wie kann dieser fatale Trend, der die politische Mitte zermalmt, noch aufgehalten werden? Es ist ein langer Weg, aber er beginnt mit dem Bewusstsein, dass es in einer Demokratie nicht nur um die eigenen Überzeugungen geht, sondern um die Fähigkeit, sich auf andere Perspektiven einzulassen und diese zu respektieren. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass Kompromisse keine Schwäche sind, sondern die Grundlage einer funktionierenden politischen Kultur. Denn der wahre Kern einer Demokratie ist nicht der Kampf zwischen gut und böse, sondern der Dialog zwischen verschiedenen Ideen und Weltanschauungen.
Was uns derzeit fehlt, ist die Bereitschaft, diesen Dialog wieder zu führen. Es bedarf einer Kultur der Rücksichtnahme und der Bereitschaft, den anderen nicht sofort als Feind zu sehen, nur weil er eine andere Meinung hat. Der Verlust der politischen Mitte ist nicht nur eine politische, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Denn eine Gesellschaft, die sich nicht mehr im Dialog übt, sondern nur noch in monologischen Selbstvergewisserungen verharrt, ist eine, die sich selbst immer weiter isoliert.
Am Ende bleibt die Frage: Ist es noch möglich, diese Mitte zurückzuerlangen? Der Versuch ist es wert. Doch es wird nicht einfach sein. Der Diskurs wird weiterhin zunehmend polarisiert sein, und der Versuch, ihn zu versachlichen, wird immer schwieriger. Aber wenn wir aufhören, auf die Mitte zu setzen, wenn wir den Dialog mit denjenigen aufgeben, die nicht in unser Weltbild passen, dann verlieren wir mehr als nur die politische Mitte. Dann verlieren wir die Fähigkeit, gemeinsam Lösungen zu finden. Und das wäre der wahre Verlust.