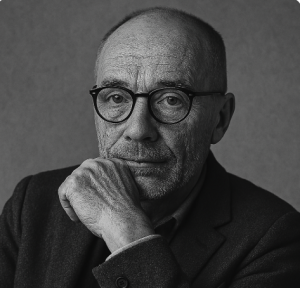Es ist schon fast ein Witz: Je mehr wir uns als einzigartig, unverwechselbar und authentisch definieren, desto mehr gleichen wir uns in unserem Drang, uns selbst zu finden. Wer den Spiegel in dieser Zeit anschaut, sieht nicht nur sein eigenes Gesicht, sondern auch das vieler anderer, die sich ebenfalls in einer Welt verfangen haben, in der das Streben nach Originalität zur Norm geworden ist. Was wäre das Leben, wenn es keinen einzigen Moment gäbe, in dem wir uns nicht selbst feiern können? Wenn sich nicht jede Geste, jede Entscheidung und jedes Outfit zu einem Manifest der eigenen Selbstverwirklichung entwickelt?
Wohl kaum ein Konzept ist in der heutigen Gesellschaft so überstrapaziert und doch so wenig verstanden wie das der Authentizität. Was bedeutet es eigentlich, authentisch zu sein? Für den einen ist es das, was man tut; für den anderen, was man sagt, und für wieder andere schlicht das, was man empfindet. Im Zeitalter des Personal Branding und der sozialen Netzwerke hat das Streben nach Authentizität allerdings eine neue Dimension erreicht. Jeder ist bemüht, ein individuelles „Ich“ zu präsentieren, als ob es ein in Stein gemeißeltes Kunstwerk wäre – und das nicht nur vor sich selbst, sondern vor einem Publikum, das aus Zehntausenden, Hunderttausenden oder Millionen von anderen besteht, die ebenfalls ein „Ich“ präsentieren. Doch gerade in dieser Selbstinszenierung liegt die Crux.
In den letzten Jahrzehnten haben wir gelernt, dass alles, was individuell und einzigartig erscheint, auch einem gewissen Maß an sozialer Bestätigung bedarf. Wer sich authentisch zeigt, muss nicht nur authentisch sein, sondern sich auch in der Anerkennung des Kollektivs beweisen. Es reicht nicht mehr, sich selbst treu zu bleiben – die andere Seite der Medaille ist die „Reaktion“ der Gesellschaft auf dieses individuelle „Ich“. Die Authentizität wird zur Ware, zum Produkt, zur Inszenierung, die verkauft werden muss. Wer keine Likes, keine Follower, keine Bestätigung erhält, riskiert, im Dickicht der Unauffälligkeit verloren zu gehen.
Der Begriff der Authentizität hat sich daher zu einem Widerspruch entwickelt. Er ist der Versuch, eine Identität zu behaupten, die zugleich niemals ganz durchdringbar ist, weil sie ständig in Bewegung ist. Der postmoderne Mensch hat erkannt, dass die Suche nach einem festen Selbstbild ein vergebliches Unterfangen ist. Stattdessen werden wir zu Sammlern von Identitäten, zu wandelnden Katalogen aus Erlebnissen, die zu jeder Zeit in andere Schubladen gesteckt werden können. Jemand, der vorgibt, „authentisch“ zu sein, zeigt in Wahrheit nichts anderes als ein verzweifeltes Ringen um Kontrolle in einer Welt, die mehr denn je von Unkontrollierbarkeit geprägt ist.
Und während sich jeder dieser Aufgabe hingibt, wird die Kluft zwischen dem, was wir für authentisch halten, und dem, was uns als authentisch zugeschrieben wird, immer größer. Wer sich in der Vielfalt der Möglichkeiten verliert, ist nicht wirklich frei. Freiheit wird zur Illusion, wenn sie nur im Rahmen dessen existiert, was für authentisch gehalten wird. In dieser Welt scheint niemand mehr sicher zu sein, wer er wirklich ist – und wenn jemand behauptet, er sei es, dann spätestens stellt sich die Frage: „Wer hat ihm das zugeschrieben?“
Diesen paradoxen Zustand zu akzeptieren, ist für viele schwer, weil er uns mit einer unerträglichen Widersprüchlichkeit konfrontiert. Die Identität, die uns im Laufe der Geschichte als eines der letzten wirklich festen Elemente verkauft wurde, ist im Internetzeitalter nicht mehr das, was sie einst war. Sie hat ihre Verlässlichkeit verloren. Niemand ist mehr der, der er vorgibt zu sein, und niemand weiß mehr genau, wer er eigentlich sein soll. Authentizität wird zur Bühne, die im permanenten Spotlight steht, ohne jemals zu einem klaren, festgelegten Punkt zu kommen.
Klar ist jedoch, dass die Vorstellung, authentisch zu sein, einen hohen Preis hat. Dieser Preis ist nicht nur materieller Natur, sondern auch sozialer. Während das Streben nach Authentizität eine Fassade der Befreiung vorgaukelt, stellt es uns vor eine paradoxe Aufgabe: Wir müssen uns von allem befreien, um dann zu erkennen, dass wir uns nur in eine neue Form der Abhängigkeit begeben haben. Und je mehr wir uns dieser Wahrheit entziehen, desto verstrickter werden wir in die Anarchie der Individualität. Jeder Versuch, sich von der Vielzahl der Einflüsse zu befreien, führt uns nur zu einer weiteren Verschiebung – zu einer weiteren Erwartung, die von außen an uns gestellt wird. Wer glaubt, er könne sich vom Diskurs der Gesellschaft emanzipieren, begibt sich in die Falle der Selbstverwirklichung.
Das Streben nach Authentizität ist nicht nur ein persönliches Anliegen, es hat kollektive Dimensionen. In einer pluralistischen Gesellschaft sind wir ständig mit anderen Vorstellungen von Identität konfrontiert. Jede dieser Vorstellungen hat das Potenzial, unsere eigene Wahrnehmung von „authentisch“ zu destabilisieren. Wer authentisch ist, muss sich ständig gegen die Vielfalt der Authentizitäten behaupten, um nicht im Ozean der Beliebigkeit unterzugehen. Doch wer überlebt, wenn jeder für sich beansprucht, die einzig wahre Form der Authentizität zu leben? Der Konflikt ist unvermeidlich, denn es gibt so viele Authentizitäten wie es Menschen gibt – und jede dieser Authentizitäten beansprucht das gleiche Recht, gehört zu werden.
Was bleibt, ist die Frage: Kann es überhaupt einen authentischen Menschen geben, wenn dieser Mensch in der ständigen Auseinandersetzung mit der Authentizität anderer lebt? Die Antwort, so scheint es, ist ein weiteres Paradoxon: Die einzige Möglichkeit, authentisch zu bleiben, ist die stetige Auseinandersetzung mit der Frage, was Authentizität eigentlich bedeutet. Doch je mehr wir uns in diese Frage vertiefen, desto weiter entfernen wir uns von der Antwort. Authentizität ist eine Zielvorstellung, die uns fortwährend entgleitet.
Es ist diese ewige Flucht vor der definitiven Antwort, die die Authentizität zur tragischen Gestalt unserer Zeit macht. Sie ist weder ein Zustand noch ein Endpunkt, sondern ein Prozess. Ein Prozess, der uns dazu zwingt, uns immer wieder neu zu erfinden, uns ständig zu hinterfragen, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Doch in diesem ständigen Umherirren liegt die eigentliche Anarchie der Individualität verborgen. Wer wirklich authentisch sein will, muss sich von der Vorstellung befreien, überhaupt authentisch zu sein. Aber auch dieser Gedanke wird bald wieder zum Konsens, zur normierten Vorstellung vom authentischen Individuum.
Am Ende bleibt nur die Erkenntnis, dass die Anarchie der Individualität ebenso eine Anarchie der Gesellschaft ist. Wir leben in einer Welt, in der die Grenzen zwischen dem, was authentisch ist, und dem, was lediglich als solches inszeniert wird, verschwimmen. In dieser Anarchie gibt es keine einfachen Antworten, keine klaren Definitionen und keine festen Wahrheiten. Nur ein endloser, chaotischer Fluss von Selbstinszenierungen, der immer wieder von uns verlangt, uns selbst neu zu erfinden.